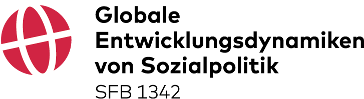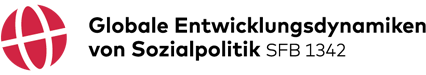Donnerstag, 14.03.2024, 12-16 Uhr, Jade Hochschule in WilhelmshavenAuf die Bedeutung einer fairen und gleichwertigen Verteilung von Sorgearbeit macht regelmäßig der Equal Care Day (ECD) aufmerksam. Am 29. Februar findet der diesjährige Aktionstag der Initiative Equal Care Day in vielen Städten und virtuell statt. Der Equal Care Day ist eine Initiative von klische*esc e.V. Ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Wahlfreiheit jenseits limitierender Rollenklischees.
Die Initiative Equal Care Day ruft Menschen, Institutionen und Verbände weltweit dazu auf, den Aktionstag ‚Equal Care Day‘ zu organisieren, zu begehen, und als Anlass zu nutzen, um einmal mehr auf die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung von Care-Arbeit aufmerksam zu machen. Das schaffen die Aktionen indem sie durch Veranstaltungen, Aktionen, Manifeste, Projekte aller Art, den Fokus darauf richtet, dass Care-Arbeit und Pflege, Care-Arbeiter*innen und Sich Kümmernde in unserer Gesellschaft und dem aktuellen Wirtschaftssystem allzu oft schlecht bis gar nicht honoriert werden. In diesem Sinne wird auch 2024 an vielen Orten und auf einer Online-Plattform zu einem ECD-Festival eingeladen.
Die Organisatorinnen des Equal Care Day Nordwest 2024 Andrea Schäfer (Universität Bremen), Nicole Biela (Stadt Wilhelmshaven) und Ann-Kathrin Cramer (Landkreis Friesland) stellen im Sinne des ECD klar „(Ver)Sorge(n) betrifft uns alle, früher oder später im Lebensverlauf, aber wir sind mit ganz unterschiedlichen regionalen Strukturen konfrontiert und einer Erwerbs- und Sozialpolitik, die (Ver)Sorge(n) nur punktuell mitdenkt. Die Folgen sind uns allen seit Jahren bewußt, nun muss es endlich Lösungen geben. Die wollen wir gemeinsam am 14.03.2024 beim Equal Care Day Nordwest 2024 mit Interessierten, Betroffenen, Expert*innen und Entscheider*innen aus Politik und Wirtschaft diskutieren.“
Equal Care Day Nordwest 2024
Der Equal Care Day Nordwest 2024 geht der Frage des „(Ver)Sorge(n) im Lebensverlauf“ mit dem Blick vor allem auf die Pflege in den verschiedenen Regionen im Nordwesten - von Friesland, über Wilhelmshaven bis nach Bremen, in den Städten und Gemeinden, nach. Damit werden Fragen nach den Lösungsmöglichkeiten im Gesundheits- und Pflegesystem in der Nordwestregion gestellt: Welche Sorgelücken und moralischen Verletzungen ergeben sich angesichts einer reparativen Sozialpolitik und einer Sichtweise auf den Pflegeberuf, die Frauen gesellschaftlich marginalisiert und der Lächerlichkeit preisgibt. Wie sieht ein Modell einer vorbeugenden Sozialpolitik, die eine neuen Normalität von Erwerbsarbeit und Care im Lebenslauf in den Blick nimmt aus? Wer sind die Menschen, die sich Tag und Nacht im Gesundheits- und Pflegesystem Deutschlands darum kümmern, dass wir gut versorgt werden, gesunden oder in Würde sterben können? Wie kann der Alltag in der Pflege oder die Routinen als Care-Arbeiter*in im privaten Raum mithilfe der Sorgenden sichtbar werden? Welche betrieblichen und politischen Handlungsoptionen gibt es um die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege konkret und nachhaltig zu verändern? Welche Bedarfe haben junge Pflegende und ihrer Familien und welche Lücken zeigen sich in den Unterstützungsangeboten in den Regionen? Das, dafür eigens gegründete, Netzwerk lädt alle Interessierten ein gemeinsam zu diskutieren, zu erfahren und zu erleben.
Programm des ECD Nordwest 2024
(ab 12:00 Uhr) Grußworte
Ann-Kathrin Cramer (Landkreis Friesland)
Prof. Dr.-Ing. Holger Saß (Jade Hochschule)
Birgit Ahn (Metropolregion Nordwest)
(ab 12:15 Uhr) Es kann jeden treffen? Care und Nursing aus der Genderperspektive
Lesung von Monja Schünemann (Medizinhistorikerin und Fachkrankenschwester) aus ihrem Buch „Der Pflege-Tsunami. Wie Deutschland seine Alten und Kranken im Stich lässt.“
(ab 13:05 Uhr) Das Optionszeitenmodell. Zeit für Care, Zeit für Gleichstellung.
Impulsvortrag und Diskussion von Dr. Karin Jurczyk (Stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik) und Prof. Ulrich Mückenberger (Universität Bremen)
Parallele Workshops ab 14:15 Uhr (Teilnahme nur vor Ort möglich)
- Arbeitsbedingungen in der Altenpflege konkret und nachhaltig verbessern - Ideen für eine Entlastungs- und Fachkräfteoffensive in der Pflege
Workshop mit Impulsvortrag und Diskussion von Greta-Marleen Storath (Arbeitnehmerkammer Bremen)
- "Das gibt es doch gar nicht!" Deine improvisierte Care-Geschichte.
Workshop mit Methoden des Improvisationstheater von Lena Breuer (Schauspielerin, Moderatorin und Trainerin aus Köln)
- Who cares? Wen kümmert´s, dass wir uns kümmern.
Workshop mit Filmvorführung und Diskussion von Ann-Kathrin Cramer (Landkreis Friesland)
- Fürsorge geben. Hilfe bekommen: Pflegende Jugendliche und junge Erwachsene
Workshop mit Forscherin und Engagierten im Dialog von Andrea Schäfer (Universität Bremen) mit Prof. Dr. Claudia Stoll (Hochschule Bremen)
Das Netzwerk ‚Equal Care Day Nordwest 2024‘
Das Netzwerk ‚Equal Care Day Nordwest 2024‘ finden in Kooperation zwischen Jade Hochschule, der Universität Bremen, dem Landkreis Friesland und der Stadt Wilhelmshaven statt. Am Netzwerk beteiligt sind darüber hinaus, die Arbeitsnehmerkammer Bremen, die Bildungsregion Friesland sowie die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden Friesland, Zetel, Wangerland und Sande, der Verein Agenda Varel, die Stadt Jever und weitere Engagierte. Veranstalterinnen sind Andrea Schäfer (Universität Bremen), Nicole Biela (Stadt Wilhelmshaven), Ann-Kathrin Cramer (Landkreis Friesland) und Mareike Sprock (Jade Hochschule). Andrea Schäfer organisiert zum vierten Mal den ECD in Bremen und umzu.
Weitere Informationen:
Der Equal Care Day Nordwest 2024 findet am Donnerstag, 14.03.2024, von 12 bis 16 Uhr an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven statt. Die Veranstaltung ist öffentlich, z.T. digital (12:00 – 14:00 Uhr) und kostenlos.
Anmelden können Sie sich hier.
Fragen beantworten:
Andrea Schäfer
Sfb 1342 "Global Dynamics of Social Policy"
Universität Bremen
E-Mail: andrea.schaefer@uni-bremen.de
Telefon: + 49 421 218-57095
Nicole Biela (Gleichstellungsbeauftragte)
Stadt Wilhelmshaven
Rathausplatz 1
26382 Wilhelmshaven
E-Mail: Nicole.Biela@wilhelmshaven.de
Telefon: +49 4421 162302
Ann-Kathrin Cramer (Gleichstellungsbeauftragte)
Landkreis Friesland
Lindenallee 1
26441 Jever
E-Mail: a.cramer@friesland.de
Telefon: +49 4461 919-6161
Gefördert von der METROPOLREGION NORDWEST
Kontakt:Andrea Schäfer