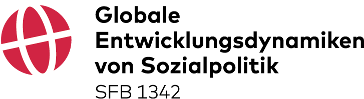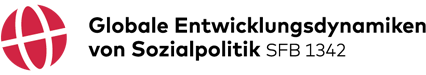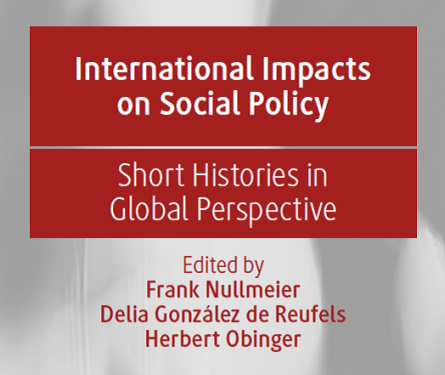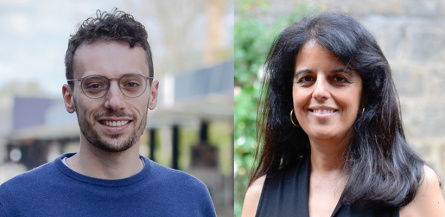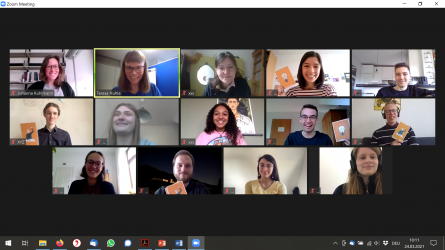Delia González de Reufels und Simon Gerards Iglesias sprechen über die Ergebnisse von Teilprojekt B02, wie sie mit pandemiebedingten Einschränkungen umgegangen sind und was an der Kooperation von Geschichts- und Politikwissenschaft besonders reizvoll ist.Ihr standet vor der Mammutaufgabe, 90 Jahre sozialpolitische Entwicklung in drei Ländern zu untersuchen - wie habt ihr diese Aufgabe strukturiert?
Simon Gerards Iglesias: Für die drei Länder gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Ich untersuche den Fall Argentinien und habe einen Schwerpunkt auf die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) gesetzt, die erst seit 1919 existiert. Als zentralen Untersuchungszeitraum habe ich die Folgejahre bis zum Zweiten Weltkrieg definiert, denn in dieser Phase beherrschten bestimmte Strukturen die Beziehungen zwischen der ILO und Argentinien und es wurde der Grundstein für die zukünftige Entwicklung der Beziehungen gelegt.
Der Untersuchungszeitraum im Teilprojekt ist in der Tat lang, dennoch lässt er sich sinnvoll betrachten, weil er von langen Entwicklungslinien durchzogen ist. Was immer wichtig war, ist etwa der der transnationale Wissensaustausch. Das sehe ich auch in Argentinien vom 19. Jahrhundert bis heute: Dort wird immer geschaut: Was passiert in Europa? Und noch ein Punkt: Wir finden gewisse Pfadabhängigkeiten. Wenn wir z.B. die Arbeitsschutzgesetze für Frauen in Argentinien und anderen lateinamerikanischen Staaten betrachten, stellen wir fest, dass hier sehr früh durchaus restriktive Regelungen bestanden. Sie waren tatsächlich restriktiver als in Europa. In Argentinien gab es Gesetzte wie z.b. die Ley de silla, übersetzt als das „Stuhlgesetz“: In jedem Industriebetrieb musste für jede angestellte Frau ein Stuhl zur Verfügung stehen, der für Erholungspausen gedacht war. Denn in Argentinien war die Gesundheit von Frauen vor allem mit der Sorge um die Gesundheit von Müttern und damit der zukünftigen Generation verknüpft, weshalb man Frauen mehr Erholungspausen auf der Arbeit zugestand. Auch heute noch findet man dieses Gesetz in einer gewissen Form sodass aufmerksame Reisende in Argentinien überall Stühle, selbst an den kuriosesten Orten entdecken können. Der Hintergrund erschließt sich aber nur denjenigen, die einen Bezug zu den argentinischen Arbeitsschutzgesetzen herstellen können.
Delia González de Reufels: An dem von Simon genannten Beispiel sieht man sehr deutlich, dass die Sozialpolitik bis heute sichtbare Spuren hinterlassen und auf die Anliegen der jeweiligen Länder reagiert hat: Die Länder des Cono Sur hatten im 19. und auch im frühen 20. Jahrhundert prekäre Demographien. In Europa, wo die sich die Bevölkerung damals exponentiell entwickelte, mögen Arbeitgeber relativ gelassen darauf geschaut haben, dass auch schwangere Frauen an der Maschine stehen und extreme Arbeitszeiten hatten. Das war im Cono Sur allerdings anders: Dort gab es weniger Kinder und das wurde als Problem benannt und von der Sozialpolitik aufgegriffen. Das „Ley de silla“ mag heute skurril anmuten, aber die Zukunft der Nation entschied sich damals durchaus auch an der Werkbank, zumindest dann, wenn eine schwangere Frau an ihr stand. Wenig überraschend war die Bevölkerungsentwicklung eine der Entwicklungslinien, entlang derer sich gesellschaftliche Diskussionen entsponnen, die man sehr gut über 90 Jahre verfolgen kann.
Und während dieser neun Jahrzehnte überschlagen sich ja glücklicherweise nicht alljährlich die Ereignisse. Es ist eher ein Prozess der Anreicherung mit wichtigen Punkten der Kulmination. Es bedurfte ja zunächst einmal eines Problembewusstseins. Der Staat nahm sich nicht sofort aller Probleme an, sondern traf eine Auswahl. In Chile beginnt unser Untersuchungszeitraum im 19. Jahrhundert, und im Jahre 1850 äußerte die Regierung erstmals, es könne nicht angehen, dass die Menschen in die Krankenhäuser gingen, um dort zu sterben. Diese waren so schlecht ausgestattet, dass Patienten keine Chance hatten, geheilt zu werden. 1850 wird also erstmals darüber diskutiert, wie staatliches Geld, genauer: Einnahmen aus Handel und Zöllen, in die Entwicklung eines funktionierenden Krankenhauswesens umgeleitet werden können. Gesundheit war bis dahin Privatsache, aber 1850 tritt der chilenische Staat erstmals in diese Verantwortung ein und beginnt, öffentliche Gesundheit als ein Feld politischen Handelns zu begreifen. Und ab diesem Moment erweitert sich der Bereich der Gesundheitspolitik um weitere Elemente. Um dies zu beobachten, sind die 90 Jahre eigentlich ideal.
Eure Arbeit ist nicht nur räumlich, sondern auch thematisch aufgeteilt. Delia, du untersuchst in Chile vor allem die Entwicklung der Gesundheitspolitik, Simon in Argentinien den Arbeitsschutz. Wie kam es zu dieser Aufteilung?
Delia González de Reufels: Alle sozialpolitischen Felder wirken natürlich in allen diesen Ländern. Aber für den Fall Chiles habe ich festgestellt, dass viele Entwicklungen im Arbeitsschutz aus dem Gesundheitsschutz hervorgegangen sind. Also aus der Beobachtung, dass bestimmte Arbeitsverhältnisse die Gesundheit der Menschen unterminieren. Diese Beobachtung wurde fand im Gesundheitswesen statt, und daher war es sinnvoll, in der Gesundheitspolitik einen Schwerpunkt zu setzen.
Und im Falle Argentiniens haben wir den Arbeitsschutz als Schwerpunkt, weil in Buenos Aires das ILO-Büro für Lateinamerika gegründet wurde: Nachdem Südamerika zunächst von Madrid aus administriert wurde, zog die ILO mit einem eigenen Büro nach Buenos Aires um und war dort präsent. Um diese Entwicklung und deren Folgen im Projekt abbilden zu können, haben wir diese Trennung vorgenommen. Hieraus ergibt sich ein vollständigeres Bild als wenn alle Entwicklungen in allen Ländern nachvollzogen werden.
Simon Gerards Iglesias: Die Trennung hilft uns auch, damit wir trotz des großen Zeitraums die geschichtswissenschaftliche Lupe d.h. diesen analytischen Zugang anwenden können. Das geht nur bei thematischer Aufteilung. Zum Arbeitsschutz: In Argentinien gab es ein wichtiges Gesetz im Jahr 1915, das den Arbeitsschutz für IndustriearbeiterInnen neu definierte: Es regelte Schadensersatzregelung für Arbeitsunfälle und räumte der Arbeiterklasse erstmals ein wichtiges einklagbares Recht zur monetären Entschädigung ein, was ein großer Schritt zur späteren Sozialversicherung war. An dieses Gesetz haben sich viele Regelungen angeschlossen, auch viele bilaterale Abkommen mit europäischen Staaten wurden daraufhin geschlossen. Dieses Beispiel zeigt, dass Sozialpolitik im frühen 20. Jahrhundert viele transnationale Verflechtungen hatte und in einer frühen Phase der Entwicklung des Wohlfahrtsstaates bereits Rechte für Minderheitengruppen, wie etwa ausländischen ArbeiterInnen eingeführt wurden.
Delia González de Reufels: In Argentinien rückt die Arbeit einer supranationalen Organisation in den Vordergrund, die beide Bereiche- Arbeit und Gesundheit- betrachtet hat. Für den Gesundheitsschutz hätten wir die PAHO, gegründet 1902, in den Mittelpunkt stellen können. Allerdings begann in Chile begann die Gesundheitspolitik deutlich früher und war eng verknüpft mit der Professionalisierung der Medizin, die uns hier besonders interessiert hat, weil sie für die Entwicklung der Public Health von großer Bedeutung war. So haben wir schon Geschichte vor der Gründung der PAHO, die einzufangen ist. Und besonders wichtig ist, dass die ILO Themen aufgreift, die vorher seitens des Gesundheitsschutzes schon diskutiert wurden. Durch unsere Aufteilung im Projekt haben wir diese Dynamik einfangen können.
Auf welche anderen, großen Einflussfaktoren oder Mechanismen für sozialpolitische Entwicklungen seid ihr bei eurer Arbeit gestoßen?
Delia González de Reufels: Es hat sich bestätigt, dass sich die Länder gegenseitig aufmerksam beobachtet und auch voneinander gelernt und Initiativen der anderen aufgegriffen haben. Es gab eine intrinsische Motivation auf den als wichtig erkannten Feldern durch eigene Maßnahmen hervorzutregen, es gab aber auch in einem Wettbewerb untereinander. Argentinien und Chile beobachteten sich sehr genau, obwohl ja in der Region mit Uruguay ein Nachbar vorhanden ist, der sehr reformaffin war und sich selbst sehr über den sozialpolitischen Fortschritt definiert hat. Trotzdem war der Blick der Chilenen und Argentinier aufeinander gerichtet. Und natürlich nach Europa.
Simon Gerards Iglesias: Die Argentinier schauten ebenfalls in viele Richtungen, immer aber auch nach Europa. Die Argentinier sahen sich eigentlich nicht als Lateinamerikaner, sie betonten immer ihre besondere Verbindung nach Europa. Das sieht man in der Mode, der Architektur und so weiter. Europa ist dann auch in der Sozialgesetzgebung ein wichtiger Referenzpunkt. Spanien wird nicht als alte Kolonialmacht gesehen, und wenn, dann als positive, die mit den sogenannten „Leyes de Indias“ die ersten Sozialgesetze eingeführt hat. Argentinien wusste, dass es nicht so industrialisiert war wie Europa, gleichzeitig wollte es so werden und schaute sich viele Dinge ab - die Industrialisierung, aber auch die damit zusammenhängende Sozialgesetzgebung.
Was wichtig ist in Bezug auf die Rolle der ILO: Ich habe den Eindruck, dass die Konventionen und Empfehlungen gar nicht so einen großen Einfluss auf die nationalen Sozialgesetzgebungen haben. Es besteht das klassische Problem internationaler Kooperation: Man einigt sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Dadurch sind viele Konventionen relativ schwach und schwammig, sie lassen viel Interpretationsspielraum zu, ohne wirklich einen höheren Standard zu etablieren. Das gilt für Argentinien ganz deutlich. Dort wurden Konventionen erst sehr spät ratifiziert und nur in gewissen Bereichen umgesetzt. Es gab ein cherry picking von Konventionen für die Bereiche, wo es bereits sehr ausgefeilte Gesetze gab. Dadurch wirkten sich die Konventionen meist weder positiv noch negativ auf die argentinische Gesetzgebung aus.
Dennoch war die ILO ein ganz wichtiger Akteur: Und zwar als Plattform und Scharnier zur Wissensgenerierung in der Sozialpolitik. Die ILO war als erste und damals einzige Organisation in der Lage, große vergleichbare Studien durchzuführen. Sie hatte auch eine riesige Bibliothek und Archive aufgebaut, die von Argentiniern benutzt wurden. Das sieht man auch in den Korrespondenzen. Gerade im Bereich der Sozialversicherung wurde sehr viel bei der ILO angefragt, weil sie einen unfassbar großen Wissensschatz aufgebaut hatte.
Ihr berichtet, dass diese Länder sehr stark auf ihre Nachbarn und Europa geschaut haben. Die Welt war damals nicht so vernetzt wie heute. Was waren denn die Wege des Austausches?
Delia González de Reufels: Die Welt war damals viel vernetzter, als wir uns das heute vielfach vorstellen. Damals gab es enge Verbindungen, nicht per Flugzeug, sondern per Schiff. Wenn wir uns die Organisationen, aber auch die Militärs anschauen, so waren das hochmobile Persönlichkeiten, die reisen und Dinge in Europa eigens in Augenschein nehmen konnten. Das gilt auch für Ärzte. Ideen reisen mit den Menschen, sie reisen auch in Schriften. Die Akteure haben Französisch gelesen, Deutsch, Englisch und auch Italienisch. Gerade die Ärzte haben ein breites Spektrum europäischer Sprachen beherrscht, um die Fachzeitschriften rezipieren zu können und auf dem jeweils neuesten Stand ihrer Disziplin zu sein; zumindest gilt das für die Koryphäen. In der ältesten und bis heute veröffentlichten Mediziner-Zeitschrift, fand sich daher auch immer eine Art Reader's Digest, der zusammenfasste, was gerade in internationalen Fachzeitschriften diskutiert wurde. So konnte die gesamte Ärzteschaft an den medizinischen Fortschritten teilhaben. Zum Teil hat man den Eindruck, die Autoren stehen dabei, wenn Robert Koch wieder eine Entdeckung macht, ihre Begeisterung darüber ist den Texten ebenso zu entnehmen wie der Stolz auf die eigene Disziplin, die sich beständig fortentwickelte und zur Lösung der Probleme der Zeit in Chile und anderenorts einen Beitrag leisten würde.
Simon Gerards Iglesias: Auch von Seiten der ILO gab es zahlreiche Versuche, stärker auf diese südamerikanischen Länder einzuwirken, Menschen zu erreichen und in die Diskurse hineinzukommen. Das beginnt mit spanischsprachigen Publikationen in den 1920er-Jahren. Dann gab es Reisen von ILO-Präsidenten, von Albert Thomas und Harold Buttler und anderem ILO-Personal, die alle nach Argentinien, Uruguay und Chile reisten, um dort die Arbeit der ILO vorzustellen und für ihre Organisation zu werben. Auf der anderen Seite gibt es Interesse und Engagement von den nationalen Behörden: Die argentinische Arbeitsbehörde veröffentlicht in ihrem Bulletin Unterlagen von ILO-Konferenzen und deren Protokolle werden ins Spanische übersetzt. Diese Zeitschrift wurde Sozialpolitikexperten in Argentinien gelesen, und so trug man die Debatten und das Wissen nach Argentinien hinein.
Argentinien war für die ILO immer das wichtigste Land, um ganz Lateinamerika zu erreichen. Das lag daran, dass- wie Delia schon sagt- Chile nach Argentinien schaute und die kleineren Länder erst recht. Deswegen wählte man z.B. Alejandro Unsain, einen Sozialrechtler aus Argentinien, in ein Gremium der ILO, ins Präsidium. Auch die erklärte Feministin und Sozialistin Alicia Moreau de Justo wird als einzige Repräsentantin aus einem Land der Südhalbkugel Mitglied der Kommission für Frauen und Kinder. Man hat also versucht, argentinische Akteure einzubeziehen, nach Genf zu holen und so den Austausch und die Wissensproduktion gefördert.
Delia González de Reufels: Argentinien hatte der ILO als entwickeltes Land auch eine besondere Infrastruktur zu bieten. Das gilt auch für Chile. So fand dann in den 1930er-Jahren eine große ILO-Tagung in Santiago statt. Chile hat es genossen, dass die Welt auf Santiago schaute. Das ließ man sich auch etwas kosten, auch in Zeiten, als das Geld knapper war. Das gilt auch für die Kongresse der Lateinamerikanischen Mediziner, deren Idee in Chile entwickelt wurde. Zugleich richtete das Land den ersten Kongress aus, der eine Weiterentwicklung des ersten chilenischen Medizinerkongresses darstellte. So waren die nationale Entwicklung und die transnationale eng miteinander verwoben.
Wir haben feststellen können, dass es immer wieder ereignisreiche Zeitabschnitte gab, die sowohl vom transnationalen Austausch als auch von Entwicklungen in den Ländern getragen wurden. Weder das eine noch das andere allein reicht aus, um eine Erklärung für die Dynamik sozialpolitischer Entwicklungen zu finden. Es gab immer eine Verbindung zwischen der transnationalen und nationalen Ebene. Erst dadurch entstand eine Dynamik, die sozialpolitische Veränderung ermöglichte. Das gilt für alle Bereiche.
Ihr habt vom eurem geschichtswissenschaftlichen Lupenblick gesprochen, ihr seid dennoch Teil des politikwissenschaftlichen SFB. Was war herausfordernd an dieser Konstellation und was war besonders gewinnbringend?
Delia González de Reufels: Herausfordernd ist, dass andere Beobachtungsräume zeitlicher Art entworfen werden. Die Geschichtswissenschaft ist immer ganz nah an der Quelle, und man sieht dann mitunter auch das größere Bild nicht, sondern muss sich das erstmal erarbeiten. Wir sind meist längere Zeit im Archiv, bevor wir daran gehen können, an Quellen unsere Theorien zu falsifizieren und Aussagen zu treffen. Da sind die die Kolleg*innen der Politikwissenschaft sehr viel schneller. Aber der SFB ist ja nicht aus dem Nichts gestartet. Es gab Jahre der Vorarbeit, es ging auch darum, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, unsere Perspektiven zu vereinen und voneinander zu lernen. Das macht es für mich bis heute so spannend. Wir kommen übrigens überwiegend zu ähnlichen Ergebnissen und ergänzen uns darüber hinaus sehr gut, obwohl wir anders auf die Dinge draufgucken.
Simon Gerards Iglesias: Ich denke, die Politikwissenschaft fokussiert sich sehr auf Methoden, z.B. die causal mechanisms, die wir uns auch erst aneignen mussten. Wir hingegen haben diesen Quellenblick, und es dauert dann meist länger, bis wir Ergebnisse vorweisen können. Aber es ist eine sehr bereichernde Kooperation. Ich habe viel gelernt und konnte z.B. Theorien zu internationalen Beziehungen gut für meine Dissertation verwenden.
Kommen wir zu einem unschönen Thema: Wie hat sich denn die Corona-Pandemie auf euer Projekt und eure Recherchen ausgewirkt?
Delia González de Reufels: Es ist wirklich bitter: Wir haben Reisemittel, die wir nicht verwenden können. Zurzeit ist vollkommen offen, wann wir wieder reisen dürfen. Und anders als viele Kolleg*innen hängen wir am gedruckten Wort: Wir müssen in die Bibliothek und in die Archive. Man kann sich zwar behelfen: Durch einen Kontakt in eine chilenische Bibliothek konnte ich etwas Material digitalisieren lassen und so an Quellen kommen. Aber das ist natürlich nur ein Ausschnitt und kann die eigene, wochenlange Archivarbeit nicht ersetzen. Denn man muss von der Ferne aus genau wissen, an welcher Stelle in welcher seriellen Publikation etwas Relevantes zu finden ist. Und man muss sich darauf verlassen, dass bei der Digitalisierung kein Fehler passiert und die Bestände vollständig sind.
Simon Gerards Iglesias: Zum Glück war ich vor zwei Jahren, gleich zu Beginnen meiner Dissertationsphase, in Argentinien und konnte dort Material sammeln. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 hat die ILO nämlich niemand mehr in ihr Archiv gelassen, was schade ist und letztlich auch ein bisschen unverständlich. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben so kaum ILO-Archivmaterial sichten können, nur solches, das bereits digitalisiert ist. Das ist zwar viel, aber darunter sind keine Korrespondenzen, Briefe und informelle Berichte. Dabei sind es gerade diese inoffiziellen Quellen, für die wir uns als Historiker*innen so interessieren. Und hoffen wir immer noch auf eine zeitnahe Öffnung, die eine Sichtung des Archivmaterials erlaubt.
Welche Veröffentlichungen sind trotz allem noch von euch zu erwarten in den nächsten Monaten?
Delia González de Reufels: Demnächst erscheint ein Working Paper, das die Ergebnisse meiner Forschungen und der von Mónika Contreras präsentiert und zur Diskussion stellt. Hier geht es um das Feld des Social Housing und wie sich das auf eine besondere Berufsgruppe auswirkt: die Carabineros de Chile. Das ist eine militarisierte und zentralisierte Polizeieinheit, die 1927 durch einen Zusammenschluss verschiedener anderer Polizeien entstanden und in ganz Chile präsent ist. Diese neue nationale Polizei war schnell in der Lage, dieses Gesetz zu nutzen, um sich als Arbeitgeber attraktiv zu machen und die Wohnungsmisere in Santiago für die Angehörigen der eigenen Einheit positiv zu wenden. Wohnen ist ja mehr als ein Ort der Unterbringung, es hat Auswirkungen auf das Familienleben, die Gesundheit, auf das soziale Gefüge. Außerdem habe ich noch zwei Aufsätze im in der Pipeline, für die ich auf Archivmaterial zurückgreifen kann, das ich vor Corona in Chile und der Conway Medical Library in Boston sammeln konnte.
Und als Teilprojekt sind wir an einem Band beteiligt, zu dessen Herausgeber*innen ich gehöre: Der Band hat das Ziel, die Breite und Dynamik der globalen sozialpolitischen Entwicklung in den Blick zu nehmen und wir sind dort auch mit eigenen Beiträgen beteiligt. Es hat Spaß gemacht, einige Ergebnisse unsere Arbeit in kurzer und prägnanter Form für unsere Länder zu präsentieren.
Simon, wann wirst du deine Promotion abschließen?
Simon Gerards Iglesias: Ich werde voraussichtlich im Spätsommer fertig. Die Veröffentlichung wird dann etwas später, d.h. nach dem Kolloquium erfolgen. Ich habe auch noch viel Material und Quellen, die ich bisher nicht gebraucht habe. Basierend darauf werde ich noch Artikel schreiben, aber das steht erst im zweiten Halbjahr an.
Kontakt:Simon Gerards Iglesias
Prof. Dr. Delia González de ReufelsSFB 1342: Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik, Institut für Geschichtswissenschaft / FB 08
Universitäts-Boulevard 13
28359 Bremen
Tel.: +49 421 218-67200
E-Mail:
dgr@uni-bremen.de