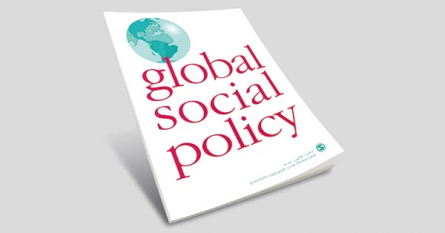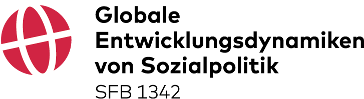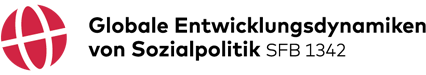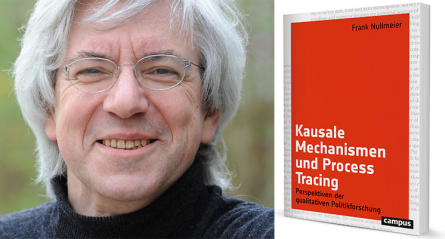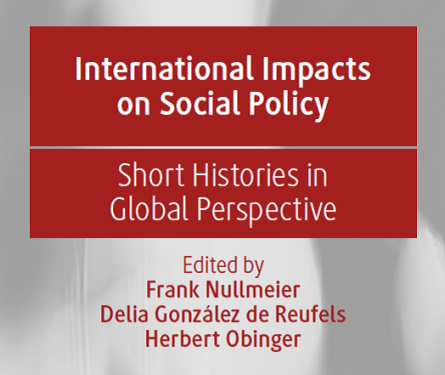KonferzenzberichtNach dem Zweiten Weltkrieg mahnte Winston Churchill: "Never let a good crisis go to waste" und wies damit auf das Potenzial hin, dass jede Krise mit sich bringt. Diese Äußerung Churchills war auch den internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz "Die Wirtschaftskrise und die Sozialpolitik im 20. Jahrhundert" am 1. und 2. Dezember 2022 bekannt, die von der Projektleitung des Teilprojekts B11, Prof. Delia González de Reufels und Prof. Cornelius Torp, organisiert wurde.
Im Mittelpunkt der Konferenz standen die beiden wichtigsten weltweiten Rezessionsphasen des 20. Jahrhunderts: die Weltwirtschaftskrise der späten 1920er und 1930er Jahre und die krisengeprägte Zeit vom Ölpreisschock Anfang der 1970er Jahre bis zur asiatischen Finanzkrise und den wirtschaftlichen Turbulenzen in Lateinamerika am Ende des Jahrtausends. Von diesen Krisen gingen wichtige Impulse für den sozialen Bereich aus und die Konferenz versuchte, diese Entwicklungen zu beleuchten. Waren wirtschaftliche Schocks jemals wirklich globaler Natur? Inwieweit prägt die Erinnerung an frühere Krisen die Reaktionen auf erneuten wirtschaftlichen Abschwung? Und in welchem Verhältnis stehen diese Krisen zur Sozialpolitik? Diese übergeordneten Fragen prägten die Vorträge und Diskussionen.
In der ersten Vortragsrunde ging es um das Zusammenspiel von Krisen, Ungleichheit und Sozialreformen. Phillip Rehm erläuterte zunächst, wie sich Krisen auf die gesellschaftliche Risikowahrnehmung und die Schaffung des Wohlfahrtsstaates auswirken. Sein Modell verknüpft "Risk flips" während einer Krise mit einer erhöhten Präferenz für Sozialprogramme. Paul Dutton zeigte dann auf, wie Historiker*innen eine neue Perspektive für die Analyse ungleicher Gesundheitsverhältnisse in der Bevölkerung einbringen können, indem sie über die medizinische Versorgung als alleinige Determinante der Gesundheit einer Gesellschaft hinausblicken.
Martin Daunton, Jason Scott Smith und Daniel Béland stellten im zweiten Diskussionspanel ihre Forschungsarbeiten über die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre und ihre Folgen in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Kanada vor. Sie konzentrierten sich auf die Straffung des Steuersystems, die Ausgaben für öffentliche Arbeitsprogramme und die unterschiedlichen Auswirkungen der Zentralisierung im Vergleich zum Föderalismus auf die Umsetzung der Sozialpolitik. So gelang es ihnen, die Reaktionen der anglophonen Länder auf die Krise und die von ihnen eingesetzten Instrumente aufzuzeigen.
In der dritten Vortragsrunde erläuterten Klaus Petersen und Ángela Vergara die Entwicklung Dänemarks und Lateinamerikas von der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren bis zu den Ölschocks in den 1970er Jahren und der daraus resultierenden Schuldenkrise in Lateinamerika in den 1980er Jahren. Indem sie sowohl interne als auch externe Einflüsse untersuchten, beleuchteten sie die Diskurse, die es den untersuchten Ländern ermöglichten, verschiedene Formen der Sozialpolitik zu etablieren.
Die Referierenden des vierten Panel der Konferenz beleuchteten die Rolle der beschäftigungspolitischen Reformen in Südkorea und Japan im Vergleich und untersuchten Arbeits- und Sozialpolitik als Reaktion auf die Krise in Australien. Juyoung An forderte dazu auf, der Gewerkschaftsstrategie größere Aufmerksamkeit zu schenken, um die unterschiedlichen sozialpolitischen Ergebnisse zu verstehen, während Gaby Ramia die Besonderheit des australischen "Wohlfahrtsstaates der Lohnempfänger*innen" hervorhob.
Zum Abschluss des ersten Tages der Konferenz stellte Carmelo Mesa-Lago in einem Vortrag seine Erkenntnisse über die Rentenprivatisierung in elf lateinamerikanischen Ländern in den Jahren zwischen 1980 und 2020 vor. Er zeigte auf, dass mit Ausnahme einer erhöhten Kapitalisierung der Pensionsfonds keines der Privatisierungsversprechen - von der Angemessenheit der Maßnahmen und der Einbeziehung vieler Beitragszahlenden bis hin zur Vereinfachung des Systems - erfüllt wurde.
Am zweiten Konferenztag beleuchteten Paolo Mattera, Raquel Varela und Paul Stubbs die Auswirkungen von Wirtschaftskrisen auf die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates in den beiden Regionen Südeuropa und Südosteuropa. Die Absicht italienischer politischer Akteure, die heimische Steuerpolitik an den Entscheidungen anderer europäischer Länder auszurichten, das Streben Jugoslawiens nach einem ideologisch unabhängigen Narrativ der Blockfreiheit oder radikale interne Veränderungen wie die Nelkenrevolution in Portugal prägen Entscheidungen im Bereich der Sozialpolitik in den jeweiligen Ländern.
Cecilia Rossel und Andrés Solimano stellten ihre Arbeiten über zwei Länder der Südhalbkugel vor: Uruguay und Chile. Die Bankenkrise in Uruguay zu Beginn des 21. Jahrhunderts führte zu einem grundlegenden Wandel in der Sozialpolitik, um einer Verschiebung der Präferenzen für sozialpolitische Maßnahmen entgegenzuwirken. Die Daten deuten darauf hin, dass diese Finanzkrise dazu führte, die Grundsätze des "Washington Consensus" von 1989 zu überdenken. Andrés Solimanos Arbeit lenkt die Aufmerksamkeit in ähnlicher Weise auf die komplexe Beziehung zwischen der zunehmenden sozioökonomischen Ungleichheit in Lateinamerika in der Zeit der Liberalisierung sowie den Antworten im Bereich der Sozialpolitik andererseits.
Die Entwicklung der Sozialpolitik im Angesicht der Krise in Asien, so der Titel des siebten Panels, wurde am Beispiel Chinas erläutert. Laut Aiqun Hu waren die Reformen für soziale Sicherheit, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten, eine Reaktion auf die Beschäftigungskrise im China der 1970er Jahre. Die Analyse zeigt, wie die Auswirkungen einer Wirtschaftskrise im Bereich der Sozialpolitik im besonderen Fall eines Systems der zentralen Planwirtschaft angegangen wurden.
Eine lebhafte Debatte rundete den zweiten Tag und damit die Konferenz ab. Insgesamt unterstrich die Konferenz die Notwendigkeit, das Phänomen "Krise" sowohl auf theoretischer als auch auf empirischer Ebene zu bewerten. Die detaillierte Untersuchung der Auswirkungen von Wirtschaftskrisen auf die Sozialpolitik aus trans- und länderübergreifender sowie historischer Perspektive ist ein wichtiges Unterfangen, das, wie die Teilnehmenden betonten, noch lange nicht abgeschlossen ist. Künftige Arbeiten könnten daher das Feld bereichern, indem beispielsweise afrikanische Länder einbezogen werden. Darüber hinaus sind verschiedene Aspekte wie das Geschlecht und die Kategorien von Arbeit, die beispielsweise zwischen formeller und informeller Arbeit unterscheiden, Faktoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Konferenz verdeutlichte, dass die Verbindung zwischen Wirtschaftskrisen und Sozialpolitik ein wesentlicher Forschungsbereich ist, der das Potenzial hat, das übergreifende SFB-Thema der globalen Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik zu erhellen.
Kontakt:Prof. Dr. Delia González de ReufelsSFB 1342: Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik, Institut für Geschichtswissenschaft / FB 08
Universitäts-Boulevard 13
28359 Bremen
Tel.: +49 421 218-67200
E-Mail:
dgr@uni-bremen.deProf. Dr. Cornelius Torp